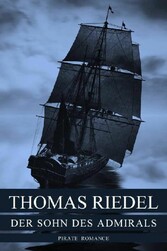Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Der Sohn des Admirals
von: Thomas Riedel
epubli, 2018
ISBN: 9783746724133 , 234 Seiten
2. Auflage
Format: ePUB
Kopierschutz: frei




Preis: 3,99 EUR
eBook anfordern 
»Und wenn er heimkommt,
ruft er seine Freunde und Nachbarn
und spricht zu ihnen:
Freuet euch mit mir,
denn ich habe mein Schaf gefunden,
das verloren war.«
Lukas 15, 4-7
Mitte April 1747 wölbte ein blauer durchsichtiger Himmel seinen ewig heiteren Bogen über die leicht bewegte Flut des Karibischen Meeres. Unter der brennend heißen Sonne Westindiens segelte die britische Korvette ›Coronation‹ mit westlichem Kurs. Auf mehrere Seemeilen durchdrang das Auge die klare und reine Luft so deutlich und sicher, wie sich in England kaum etwas auf eine halbe Meile erkennen ließ. Eine Landratte hätte an der ›Coronation‹ wohl nichts Besonderes gefunden. Wahrscheinlich hätte sie sich gefragt, warum ein solches Aufhebens um dieses Schiff gemacht wurde? Es sei ja schließlich eine Korvette wie jede andere auch.
Aber die ›Coronation‹ war keine Korvette wie andere! Sie war zwar nicht länger, mit ihren etwa achtundzwanzig Yards, aber wesentlich schlanker gebaut als üblich. Während die Masten einer Korvette normalerweise drei Rahsegel übereinander führten, hatte bei diesem Schiff jeder Mast fünf. Außerdem war die ›Coronation‹ mit zwei Klüversegeln und einem Stagsegel am Bug ausgerüstet. Am Heck besaß sie zusätzlich einen dritten Mast für ein Gaffelsegel, der allerdings in der Regel nicht ›gefahren‹ wurde, sondern zerlegt neben dem Achterdeck-Haus lag. Im Gegensatz zur herkömmlichen Bauweise stand auch der ungewöhnliche rundgattene Schluss des Rumpfes – das rundzulaufende Schiffsheck. Vor- und Hinterschiff erhoben sich nur wenig über das Mittelschiff und boten dem Wind auf diese Weise keine große Angriffsfläche, um das Schiff aus dem eingeschlagenen Kurs zu schieben.
Mit außerordentlicher Geschwindigkeit trieb die ›Coronation‹ über das Wasser. Einem sachverständigen Auge wäre sofort aufgefallen, dass sich das Schiff in höchster Alarmbereitschaft befand, denn die je zehn Kanonen an Back- und Steuerbordseite waren ausgerannt, geladen und jederzeit schussbereit. Neben jedem Geschütz war ausreichend Ersatzmunition aufgeschichtet, und die Artilleriemannschaft schlief bei den Rohren.
Am Bug der Korvette lagen zwei Matrosen im Halbschatten, die sich flüsternd miteinander unterhielten.
»Man könnte meinen, wir zögen geradewegs in den Krieg«, meinte der eine verächtlich.
Der andere warf einen Blick in die Runde, erhob sich ein wenig und spuckte seinen Priem geringschätzig über die Reling in die Gischt. »Captain Moore ist noch nie in Westindien gewesen. Die Gewässer scheinen ihm nicht recht geheuer zu sein. Vermutlich haben ihm gewisse Erzählungen über Piraten und Freibeuter den Kopf verdreht …« Dabei deutete er mit seinem Zeigefinger eine drehende Bewegung auf Höhe seiner Schläfe an und gab dazu ein unterdrücktes spöttisches Lachen zum besten.
Der andere, ein junger, gut gebauter Bursche mit schwitzendem, blankem Gesicht, der um seinen Hals ein lose geschlungenes weißes Tuch trug, machte eine wegwerfende Handbewegung. Er war zwanzig Jahre alt und Vortoppsgast. Erst vor zwei Jahren war er in den Dienst der königlichen Marine Georg II. getreten – nicht freiwillig, man hatte ihn dazu gepresst und von einem heimkehrenden Frachtschiff auf ein aussegelndes Kriegsschiff übernommen. Das Schiff hatte in See gehen müssen, ehe seine Besatzung vollzählig war. Seit zwei Jahren diente er nun auf der ›Coronation‹, hatte es aber immer noch nicht bis zum Corporal gebracht. »Pah! Piraten!« Er legte die ganze Kraft jugendlicher Verachtung in diese zwei Worte. »Das ich nicht lache! Die große Zeit der Bukaniere und Filibuster ist längst vorbei! Die Meere sind sicher geworden. Mit einem feindlichen Angriff haben wir ganz sicher nicht zu rechnen. Nein, nein, Jim …« Er brachte seine Lippen an das Ohr des anderen und flüsterte, als könne jemand seine Worte hören, fast tonlos weiter: »… der Alte ist ganz einfach ein ausgemachter Hasenfuß! Ein absolut unfähiger Mann. Der Offizier bei der Admiralität, der Captain Moore das Kommando über ein Schiff gegeben hat, gehört meiner Meinung nach am Kragen an der nächsten Rah aufgeknüpft!«
Jim richtete sich auf und strich sich erregt mit der Rechten durch den struppigen Bart. »Warum so leise, mein Freund?! Brüll deine Meinung doch einfach heraus, damit alle sie hören können. Ich garantiere, dass danach tatsächlich einer hängt. Nur wird es sicher nicht Captain Moore sein …« Er grinste abstoßend. »… sondern du!«
»Was glaubst du, warum ich flüstere?«, fuhr der andere ärgerlich fort. »Ich lebe noch ganz gern.« Er seufzte. »In wenigen Tagen werden wir Jamaica erreicht haben … dann sehen wir weiter. Mir ist nämlich auch nicht ganz wohl zumute, genau wie unserem Captain. Nur aus einem anderen Grund.«
»Und der wäre?«
»Unser Captain fürchtet sich vor eingebildeten nicht existierenden Gefahren. Ich dagegen fürchte mich vor dem Captain. Vor seiner Dummheit, seiner Unfähigkeit und seiner Feigheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns hier keine Gefahr droht! Aber soviel Feig- und Unwissenheit, wie sie bei ihm auf einen Haufen kommt, zieht die Gefahr geradezu an, wie ein Magnet das Eisen. Wenn es im Ozean nur eine einzige Klippe gäbe, Moore würde garantiert krachend auf sie auffahren. Und wenn es auf dem Meer nur einen einzigen Piraten gäbe, er würde sich mit ihm aus reiner Hilflosigkeit anlegen. Ich will wahrlich drei Kreuze machen, wenn wir endlich auf Jamaica sind.«
»Du magst ja in einigen Punkten recht haben«, erwiderte sein Kamerad nachdenklich, »aber du hättest nicht davon anfangen sollen .... Jetzt kommen mir nämlich auch Bedenken.«
Der andere begann lauthals zu lachen. Abschätzend betrachtete er seinen Kameraden, einen etwa vierzigjährigen, braungebrannten Mann unbestimmter Herkunft, der es bei seiner Tüchtigkeit längst zum Bootsmann hätte bringen können, wenn er nicht seit ewigen Zeiten immer wieder über die Stränge geschlagen und sich damit selbst um die Chance einer Beförderung gebracht hätte.
Das auch Jim Angst kannte, war neu für ihn. Denn im Verlauf der Zeit, die er mit ihm schon zusammen war, hatte er diesen als einen über jedes Maß hinaus tapferen, furchtlosen und tüchtigen Seemann kennengelernt. An Land ließ er keine Rauferei aus, und zur See war er Wortführer und bei jeder Gelegenheit der Erste und vorneweg. Wenn im Sturm das Toppsegel dicht gerefft werden musste, so war er dabei, rittlings auf der Windseite der Rah sitzend und mit beiden Händen die Zeisinge anziehend, kühn wie Alexander der Große, der sein Streitross ›Bucephalus‹ zähmt. Als würde er von Stierhörnern in den gewittrigen Himmel geschleudert, schwang sich sein jauchzendes Bild durch die Luft vor den Augen der übrigen Männer, die sich in Reihen an den Rahen abarbeiteten.
Jim begründete ihm auch sofort seinen Standpunkt: »Es ist dieses Weib, dass mir einiges zu denken gibt …«
»Das Weib ist kein Weib!«, belehrte ihn der andere. »Sie ist eine Dame.«
»Darum geht es doch gar nicht.«
»Worum dann?«
»Liegt das nicht auf der Hand?« Das Gesicht des Älteren nahm einen verdrossenen Ausdruck an. »Es geht darum, dass eine Frau einfach nicht auf ein Schiff gehört. So etwas bringt Unglück. Du solltest das wissen, Dan!«
Der andere lachte sorglos. »Pah! So ein Ammenmärchen! Was sollte denn da die Mannschaft eines Passagierschiffs sagen?«
»Wir sind aber kein Passagierschiff«, ereiferte sich Jim. »Wir sind ein Kriegsschiff Seiner Majestät ... Und die Anwesenheit einer Frau auf einem Kriegsschiff bringt nun einmal Unglück! Da beißt keine Maus einen Faden ab.« Er kramte in seiner Hosentasche und brachte eine kleine Münze zum Vorschein, die er bespuckte und über die Reling warf, ehe er sich schnell bekreuzigte.
»Jetzt fehlt nur noch, dass du eine Walflosse an die Außenwand des Schiffes nagelst, damit sich dessen Kraft auf unsere Geschwindigkeit auswirkt«, machte sich Dan über den Aberglauben seines Kameraden lustig. »Und vermutlich glaubst du auch die Hirngespinste von haarigen Meeresgeschöpfen, Riesenkraken und Seeschlangen, wie?«
»Du anscheinend nicht, aber glaub mir, du wirst schon noch sehen!«, brummte Jim verdrossen. »Ich fahre schon um einiges länger zur See, mein Freund. Was weißt du schon vom Meer mit seinen grundlosen Tiefen. Du weißt nicht, wie es ist, wenn eine Seeschlange vom Grund emporsteigt, ihren ungeheuren, mit einer dichten Mähne bedeckten Hals bis zu den Wolken hinaufreckt, sich mit ihren riesigen schwarzen glänzenden Augen auf Mastenhöhe streckt und nach Beute oder Opfern umsieht!«
Dan versuchte ein Lachen zu unterdrücken, um Jim nicht weiter gegen sich aufzubringen. »Sag mal, was hat dir die denn die arme Mrs. Montgomery angetan?«, fragte er, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. »Ihr Mann ist auf Jamaica stationiert, wie ich erfahren habe …«
»Du meinst doch nicht etwa Captain James Montgomery?«, zeigte sich Jim erstaunt.
»Keinen anderen, mein Freund. Er wurde nach Jamaica versetzt, als sein Sohn gerade einmal zwei Monate alt war, wie mir zu Ohren gekommen ist. Jetzt hat ihn wohl die Sehnsucht nach seiner Familie übermannt. Der Stammhalter kann gerade mal ein Jahr alt sein. Der Captain lässt sie eben nachkommen.«
»Sehr zum Schaden des Kindes!« Jim zeigte ein wenig fröhliches Grinsen. »Es wird wohl kaum das Klima...