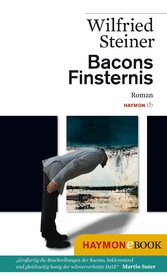Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Bacons Finsternis - Roman
von: Wilfried Steiner
Haymon, 2018
ISBN: 9783709938478 , 264 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 12,99 EUR
eBook anfordern 
I Ein Abschied
September –Dezember 2003
Eins
„Wenn wir nach Hause kommen“, sagte Isabel, „müssen wir uns trennen.“
„Gute Idee“, sagte ich und lachte. Wir saßen in einer Taverne am Strand, Isabels nackte Zehen gruben sich in den Sand, es roch nach Salzwasser und altem Frittieröl. Ich hatte gerade den letzten Bissen Dorade mit einem Schluck dieser Weine hinuntergespült, die in Griechenland so gut schmeckten. Aber wehe, man nahm sie mit nach Hause. Da offenbarten sie schonungslos ihre Mittelmäßigkeit. Allerdings schmeckten sie auch in Griechenland nur gut, wenn man Griechenland mochte. Ich mag Griechenland nicht besonders.
Die letzten beiden Wochen mit Isabel in einem von zahlreichen Kakerlaken bewohnten Apartment in Matala waren nicht ganz reibungslos verlaufen. Nicht gerade zweite Flitterwochen. Aber es war nicht wichtig. Morgen würde ich wieder in meinem Antiquariat sein, Isabel in ihrem Filmclub, Kreta würden wir nicht vermissen. Und Kreta uns auch nicht. Wir verbrachten unsere Zeit, wir bewohnten unsere Welten, wir liebten uns, wie man sich eben liebt nach fünfzehn Jahren. Wir hatten einander. Das war nicht wenig. Mehr konnte man vom Leben nicht verlangen.
Isabel nahm meine Hand. Entwand mir das Weinglas, energisch, und stellte es neben den Grätenteller. Irgendetwas hatte ihre Augen verdunkelt, das Blaugrau wich einem düsteren Anthrazit. Brach ein Sturm herein über Kreta? Oder war da nur eine winzige Wolke, direkt über ihrer Stirn?
„Hör mir zu“, sagte Isabel. „Es ist mein Ernst.“
Doch eine Sturmflut im Anmarsch. Der Boden unter meinem lächerlichen Tavernenstühlchen schwankte. Ich begriff gar nichts. Nur die Bedrohung.
„Es tut mir leid“, sagte Isabel. „Aber ich kann nicht mehr.“
Der Kellner kam, stellte zwei Gläser Ouzo vor uns auf den Tisch. Er sagte ein Wort, das man erwidern musste. Es bedeutete so viel wie „manchmal bin ich froh, dass Leute, die ich zutiefst verachte, für meinen Lebensunterhalt aufkommen“. Auf Griechisch hieß das „Jamas!“
„Jamas“, sagte ich.
„Jamas“, sagte Isabel.
Dann schwiegen wir.
Es war wohl an mir, etwas zu sagen. Aber was? „Ist das dein Ernst?“ kam nicht in Frage, das hatte sie ja schon gesagt. Es war ihr Ernst. Aber es konnte nicht ihr Ernst sein. Undenkbar. Ich trank den Ouzo in einem Schluck aus und sprach aus dennoch rostiger Kehle den dümmsten aller möglichen Sätze:
„Geht es um jemand anderen?“
Gut, ich hätte auch „hast du dich verliebt?“ sagen können, die pathetischere Variante, oder mit einem kühnen Sprung, der die selbstgebastelte Hürde gleich mitüberwunden hätte, „wer ist es?“
Aber ich sagte eben, was ich sagte. Die kretische Flut zischte herein, spritzte mir ein wenig Salzwasser ins Auge. Dort gehörte es auch hin, mittlerweile. Salz zu Salz, Wasser zu Wasser. Ich war froh, wenn wir endlich heimkamen.
„Du hast nichts begriffen“, sagte Isabel. Das wusste ich. Das war mir klar. Das stand außer Zweifel.
„Wir führen doch“, sagte ich schwach, „ein angenehmes Leben, gehen uns selten auf die Nerven, und manchmal haben wir viel Spaß miteinander.“
„Das ist genau das Problem, Arthur“, sagte Isabel. „Dass du allen Ernstes glaubst, das würde reichen. Aber mir ist das zu wenig. Ich bekomme keine Luft mehr.“ Sie fischte die Zigaretten aus ihrer Tasche und zündete sich eine an.
„Dann rauch eben nicht so viel“, sagte ich. Ich wollte sie zum Lachen bringen. Oder mich. Mittlerweile trank ich den Fusel aus der Karaffe, was meinen Würdefaktor nicht erhöhte. Isabel lachte nicht, sie stieß den Rauch so heftig aus, dass es klang, als bliese sie durch ein Bambusrohr einen Curare-Pfeil in meine Richtung. Zack! steckte er mir schon mitten in der Brust.
„Ist es“, ich versuchte es erneut, „der Altersunterschied?“ Hätte ja sein können. Immerhin zwölf Jahre. War es aber wohl doch nicht, wenn ich ihren Blick richtig deutete.
Wir schwiegen wieder ein bisschen. Das Meer hatte sich mittlerweile seinen dunkelgrauen Schlafanzug angelegt und wälzte sich unruhig von einer Seite auf die andere. Ich nahm die Gabel und trennte den Kopf der Brasse vom Rückgrat. Henker eines toten Fisches. Ich würde wieder zu rauchen beginnen, so viel war klar.
„Was ist es denn, was dir fehlt?“ Einen hatte ich noch. „Ein Abenteuer?“
„Vielleicht“, sagte Isabel, und etwas wie Verbitterung huschte über ihre Züge. Und Mitleid, das auch. „Aber nicht so, wie du dir das vorstellst.“
Woher wollte sie wissen, was ich mir vorstellte? Gut, in fünfzehn Jahren Ehe begegnete man so mancher Spukgestalt aus der Alptraumzone des anderen. Manche Ungeheuer konnten sich einfach nicht so lange verstecken. Aber was wusste man wirklich voneinander? Nichts, wie ich gerade feststellen musste. Absolut nichts.
„Was“, fragte ich, „stell ich mir denn vor?“
„Schau“, sagte Isabel, und jetzt wurde ihr Tonfall milder, aber nicht weniger bedrohlich. Ihre Studenten mussten diese Stimmlage kennen. Vor allem die unterbelichteten unter ihnen. Die unbelehrbaren. Die hoffnungslosen Fälle.
„Es ist mir alles zu eng geworden. Spießig, ritualisiert, vorhersehbar, verstehst du? Immer der gleiche Trott. Nichts Aufregendes mehr, keine Überraschungen.“
Der Kellner freute sich, dass ich noch eine Karaffe bestellt hatte. Er schleppte etwas aus dem Schuppen in die Taverne. Es war ein Plattenspieler. Der Mann fing an, Musik aufzulegen. Die erste Nummer war Owner of a Lonely Heart. Ich schwöre. Isabel ist meine Zeugin. Der Kellner hatte eine Begabung als Discjockey. Fingerspitzengefühl.
„Wie schön“, sagte ich, nahm eine Zigarette aus Isabels Packung und zündete sie an. „Sie spielen unser Lied.“
Isabel sah mich fassungslos an. Mir war nicht ganz klar, ob es an meinem Satz lag oder an der Tatsache, dass ich im Begriff war, nach zehn Jahren meine erste Zigarette zu rauchen. „Das war nicht sehr klug“, sagte Isabel, und ich war mir immer noch nicht sicher, was sie damit meinte. Die ersten Züge fuhren mir mit glühenden Dolchen in die Lunge, ich hustete, aber der Schmerz war gut, so tröstlich konkret. Verständlich, nachvollziehbar, dem Ursache-Wirkungs-Prinzip folgend, et cetera.
Hinter einem Felsen kroch der Mond hervor, diese nachtaktive Kellerassel. Auch am Funkeln der ersten Sterne konnte man sich erfreuen, wenn man wollte.
„Eigentlich doch ganz schön hier“, sagte ich. „Wollen wir nicht noch eine Woche dranhängen?“
„Ach Arthur“, sagte Isabel, „sei nicht kindisch. Komm, lass uns gehen.“
Aber ich wollte nicht gehen. Ich hielt mich an meiner Karaffe fest. Starrte abwechselnd auf Isabel und die Glut meiner Zigarette. War kurz davor, den Kopf in den Sand zu stecken. Buchstäblich. Dann hätte ich allerdings die wunderbare Musik nicht mehr gehört. I Only Have Eyes for You. Der Mann an den Tellern zog sein Pärchenbeschallungsprogramm durch, ohne Erbarmen. Isabels Gemütslage schien sich nicht ganz damit zu decken. Verliebt war sie jedenfalls nicht. Sie winkte dem Kellner, sie wollte zahlen. Ich wollte noch Wein. Der Kellner blickte von ihr zu mir und wieder zu ihr. Er wartete auf eine Entscheidung. Isabel und ich stritten. Vor allem ich stritt. Es war schön. Es war ein richtiger Ehestreit. Die Chancen, dass es unser letzter war, standen nicht schlecht.
Wir zahlten natürlich, ich bekam keine neue Karaffe mehr. „Es hat doch keinen Sinn, Arthur. Das macht es doch nicht besser.“ Isabel wollte mich stützen, als ich mich erhob, doch ich ließ es nicht zu. „Schau“, sagte ich in einer letzten Aufwallung von Trotz und streckte meine bebende Rechte in Richtung eines besonders hellen Sterns, „Venus!“
„No Venus“, sagte der Kellner. „Wega. Venus tomorrow morning.“
Ich wollte ihm gegen sein Hobbyastronomenschienbein treten, verfehlte es aber knapp und schlug der Länge nach hin, mit dem Gesicht voran in den Sand. Schmeckte nicht schlechter als der Wein, der Sand. Isabel stöhnte entnervt, es war ein dem venusfreien Himmel entgegengeschleudertes Ich-habe-die-richtige-Entscheidung-getroffen-Stöhnen, ein Stöhnen als Zeugenanrufung, das keinen Widerspruch duldete.
Sie zog mich hoch, es ging ganz leicht, ich hatte mich ergeben.
Auf dem Weg zurück ins Apartment sagte ich nichts. Es war anstrengend genug, meine Schritte zu koordinieren. Fuß vor Fuß, langsam und würdevoll, die Choreografie eines Verlorenen.
Isabel ließ mich vor der Haustür auf den Boden sinken wie eine Einkaufstasche, die zu schwer war, und schloss die Tür auf. Ich sah sofort, dass das zwei Wochen lang vergeblich verlangte, dann erbetene, am Ende geradezu erflehte Kakerlakenvernichtungsmittel endlich zum Einsatz gekommen war. Nicht, dass die Viecher jetzt weg waren. Eher im Gegenteil. Sie waren von der chemischen Attacke nur derart geschwächt, dass sie nicht mehr flüchten konnten, als das Licht anging. So war es uns vergönnt, zu sehen, wie viele es wirklich waren.
Isabel reagierte nicht. Es war erstaunlich. Sie schien sie nicht wahrzunehmen. Wie ein Luftkissenboot schwebte sie über das Gewimmel, hin zum Kühlschrank. Stützte sich für einen Moment, unendlich müde, mit beiden Händen auf, ließ den Kopf nach vorne fallen und atmete durch. Eins der Tiere kroch über ihr rechtes Handgelenk. Sie öffnete die Kühlschranktür, nahm eine Flasche Wasser heraus und leerte sie in einem Zug. Die Kakerlaken waren nicht da. Ich war...