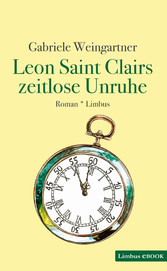Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
Leon Saint Clairs zeitlose Unruhe - Roman
von: Gabriele Weingartner
Limbus Verlag, 2019
ISBN: 9783990391761 , 360 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 14,99 EUR
eBook anfordern 
II.
Wenn Konstanze im Ausland ist, komme ich selten vor elf aus dem Bett. Nach einer langen Nacht, erst in der Morgendämmerung zurückgekehrt, zur Sommerzeit zumal, an die ich mich wohl nie gewöhnen werde, hindert mich häufig eine Amsel am Einschlafen. Vom Dachfirst gegenüber dringt sie mit ihren Gesängen so intensiv in meine Gehörgänge und dann in meine Träume ein, dass ich die Koloraturen der Weber-Schwestern zu hören meine, die vor rund zweihundert Jahren aus dem Auge Gottes genannten Haus am Petersplatz zu mir herüberklangen. Josepha, Aloysia, Constanze, Sophie – eine jede sang aus ihrem eigenen Fenster, in voller Pracht, mit hochgetürmter Perücke und großzügigem Dekolleté, in der heutigen Wirklichkeit nicht anders als in der damaligen in der Werkstatt des Notenstechers Gregor Stangerl, obgleich ich mich in einem Berliner Wohnhaus befinde, in dessen erst vierzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebauten Dachgeschoß genauer gesagt, das ein österreichischer Millionär als feudal genug empfand, es seiner Tochter zur Promotion zu schenken.
Es ist bereits der zweite Frühling, dass ich Konstanzes Amsel lausche, in deren Gesänge die Weber-Schwestern – so mir das Einschlafen gelingt – sich zuverlässig einmischen. Ob mir auch damals (fünfzehn oder sechzehn geworden inzwischen und nach meiner Wanderung durch europäische Kriegsschauplätze völlig abgerissen und fast verhungert in Wien angekommen) Amseln begegneten, weiß ich nicht. Neuere Forschungen besagen ja, dass ihre Melodien von den Menschen stammen und nicht aus ihnen selbst. Erst Ende des achtzehnten Jahrhunderts hätten sie begonnen, die Städte zu erkunden, und sich dort – irgendwann sogar dreimal im Jahr brütend – rasant vermehrt. Zur Frühzeit meines eigenen Lebens! Was für eine Meisterleistung das war nach der Vertreibung aus den abgeholzten dunklen Wäldern und trockengelegten Sümpfen, in denen sie dank ihres schwarzen Gefieders buchstäblich unsichtbar waren! In der Zivilisation der entstehenden Vorstadtgärten und feudalen Parks mutierten sie zu willfährigen Kopisten absichtslos vor sich hin trällernder, vielleicht nur in verschiedenen Tonlagen miteinander kommunizierender Stadtbewohner. Dass die Männchen mit den orangeroten Schnäbeln begannen, ihre unansehnlichen Weibchen mit ihren aus Menschensound generierten Liebesliedern kirre zu machen, dürfte in die gleiche Epoche fallen. Und bestimmt gibt es auch gute Gründe, warum dies vorwiegend so früh am Tag geschieht. Die Freunde von Nachtschwärmern sind Amseln jedenfalls nicht, selbst wenn diese verliebt sind – wie ich derzeit.
Aber ob sie wirklich wegen der menschlichen Stimmen geblieben sind? Wegen des Gesangs? In Wien hätten sie die hochkarätigsten Anregungen gehabt. Selbst mein Meister sang ja in einem fort die Weisen, die er in Kupfer trieb oder im Takt mit den unterschiedlichsten Notenwert-Stempeln auf Zinkplatten hämmerte, nicht nur Arien und Menuette von Mozart, sondern auch von Haydn oder Salieri, ganz abgesehen von den Weber’schen Ziergesängen aus dem profanen Übungsbuch, die über den Platz hinweg zu ihm in die Werkstatt drangen. Seine Kunden waren prominent, sie hatten die Nummern komponiert, mit denen die Sängerinnen später auf der Bühne brillierten, wobei die Herren ihr Geschriebenes oft selbst vorbeibrachten in seltsamer Unbekümmertheit, während sie – auf den ersten Andruck wartend – im Stehen aus notdürftig ausgewischten irdenen Schalen den Kaffee schlürften, der in einer Blechkanne simmernd auf dem Kohleofen bereitgehalten wurde.
Vielleicht habe ich ja – klein, verzagt, erst allmählich kräftiger, wenn auch nie richtig groß werdend – den einen oder anderen berühmten Tonsetzer mit eigenen Augen gesehen, obgleich sie mir nicht gerade bedeutend erschienen damals, weil Gregor Stangerl über sie zu schimpfen begann, sobald die Türglocke hinter ihnen verklungen war. Über Paul Wranitzky etwa, den mit Schönheitspflästerchen pompös herausgeputzten Dirigenten des Hofopernorchesters, der seine Herrschsucht auch in der Werkstatt nicht bezähmen konnte und Lehrlinge gern mit Fußtritten traktierte. Und auch Franz Xaver Süßmayr bekam sein Fett weg. Dass er nicht nur Mozarts Freund, sondern auch der Geliebte seiner Ehefrau sei, kursierte zwar nur als Gerücht, galt aber als sehr wahrscheinlich. Warum sich Stangerl über Mozart am meisten erregte, wundert mich dagegen nicht: Statt seine Schulden zu bezahlen, kaufte er sich beim Putzmacher gegenüber neue Perücken oder ließ sich seine älteren Modelle mit den neuesten lilablassblauen Puderkreationen bestäuben, nur um derart geschniegelt vor der Front des Ladens auf und ab zu stolzieren, wo gut sichtbar hinterm Schaufenster mein Meister saß, sang und klopfte oder sich mit seinen Gesellen über unleserliche Handschriften beugte. Weil er es meist versäumte, aufzuspringen und dem Gecken nachzustürzen, tat er irgendwann so, als sähe er ihn nicht – und fiel doch immer wieder herein, wenn der Komponist an die Scheiben klopfte und seine in ganz Wien bekannten Fratzen zog.
Keine Ahnung, ob die Drucklegung der Mozart’schen Werke Stangerl oder einen der vielen anderen Wiener Notenstecher reich machte. Die oft auf wenigen Blättern zusammengeschusterten Stücke müssten doch wie warme Semmeln weggegangen sein, die Duette und Kantaten, Ländler und Märsche, die jedermann sang oder singen wollte, denke ich, während die Amsel – inzwischen auf einen Sendemast ganz in der Nähe gewechselt – nicht aufhört zu tirilieren. Tatsache ist, dass man gern Vogelstimmen kopierte in jenen Jahren, in schöner, unbewusster Umkehrung des neuerdings vermuteten Lernvorgangs der urban gewordenen Amseln. Die dafür gebräuchlichen Trillerpfeifen waren beim Volk beliebt, viel erschwinglicher als gedruckte Notenblätter zumal, und gaben nicht nur zu allerlei privaten und öffentlichen Wettbewerben Anlass, sondern hielten irgendwann auf den städtischen Opernbühnen Einzug: Irgendwer pfiff immer. Dass es Mädchen und Frauen angeblich nicht sollten oder durften, konnte ich nicht feststellen. Ich habe viele pfeifende weibliche Wesen erlebt, hauptsächlich solche allerdings, die sich schämen mussten, wenn sie den Mund aufmachten; ihrer schwarzen Zähne wegen, oder weil sie gar keine mehr hatten.
An die Unterhaltungen über die schon von Joseph II. in goldenen Käfigen gehaltenen Vögel erinnere ich mich nur mehr schwach; das hängt wohl damit zusammen, dass ich nie dabei war bei den Ausflügen in den Schönbrunner Tierpark, zu denen sich meine Kollegen am Sonntag gern aufmachten. Bei ihrer Rückkehr erzählten sie gewiss von den Sittichen, Kakadus und Pfauen oder den Papageien mit ihrem grellbunten Gefieder, wobei die Letzteren ganz besonders seltsame, um nicht zu sagen: irrsinnige Wesen seien, welche die allerschlimmsten Schimpfwörter wiederholten, wenn man sie ihnen nur oft genug einsagte.
Deutlicher im Gedächtnis geblieben sind mir Hansi und Fränzi, die beiden blonden Geschwisterkinder, mit denen ich während der Abwesenheit der anderen durch die Werkstatt tobte, Murmeln spielte unter den kompliziert verzweigten hölzernen Gestellen der Druckerpressen hindurch oder Fangen über Bänke und Hocker, wofür ich zwar zu alt war, meine Deutschkenntnisse aber wenigstens ausreichten. Nein, sie brachten meine Einsamkeit nicht in Gefahr, sie ließen mich in meinem Sprachgefängnis verweilen, weil sie selbst auch nicht viel redeten, nicht einmal untereinander oder abends vor dem Einschlafen, wenn sie nach dem Beten Hand in Hand auf ein und denselben Strohsack krochen, ganz abgesehen davon, dass ich sie in ihrem Dialekt – wie überhaupt die Wiener, die mich umgaben – bis zum Schluss meines Aufenthaltes kaum verstand. Ob sie das Ehepaar Stangerl eigens für das Sammeln der Pferdeäpfel aufgenommen hatte, die im überdachten Teil des Hinterhofs zum Trocknen ausgebreitet wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Tatsächlich taten die beiden nichts anderes und erhielten dafür Essen und Trinken und gelegentlich ein paar gewohnheitsmäßige Ohrfeigen von Frau Stangerl, die keine Zärtlichkeit in ihrem Wesen hatte.
Sonntags kamen weniger Kutschpferde vorbei, unsere Spiele wurden selten unterbrochen. Wochentags aber mussten Bruder und Schwester in der Nähe der Türe Wache stehen und die Gasse im Blick behalten, weil die Frau des Meisters es reinlich haben wollte vor dem Geschäft und schließlich auch andere Kinder unterwegs waren, die das im Winter unentbehrliche Heizmaterial im Visier hatten. Sobald sie also Pferdegetrappel hörten, raste Hansi los und Fränzi mit Schaufel und Besen hinterher, man konnte leicht über sie stolpern oder sogar auf ihre kleinen Körper treten, wenn sie einem zwischen die Füße gerieten. Fränzi jedenfalls, durch ihr bis an die Knöchel reichendes Gewand ohnehin im Nachteil, bekam eines Tages den Stiefeltritt eines in roten Samt gekleideten bischöflichen Boten ab, der ihr wohl den Brustkorb zertrümmerte. Er bemerkte es nicht einmal, der grobe Kerl, sondern kehrte frohgemut mit einer neuen Bestellliste in die Werkstatt zurück, nachdem er die von seinem Herrn in Auftrag gegebenen Notenpacken in seinen Handkarren sortiert hatte, und wäre gewiss abermals auf die Kleine getreten, wenn ich sie nicht weggezogen und mit dem Rücken zur Wand hinter eine Druckerpresse gebettet hätte, argwöhnisch beobachtet von meinem Meister, vor dessen Augen ich meine – von Anfang an völlig bedeutungslose – Arbeit sonst nicht zu unterbrechen wagte.
Dort, an dieser Stelle, muss das Mädchen dann gestorben sein, von niemandem bemerkt, auch von mir nicht, der ich irgendwann bei einem auf Französisch zu führenden Gespräch behilflich sein sollte, und selbst nicht von Hansi, der während des ganzen Nachmittags unverdrossen die Pferdeäpfel in den...