Suche
Lesesoftware
Info / Kontakt
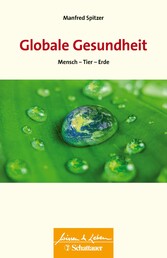
Globale Gesundheit (Wissen & Leben) - Mensch - Tier - Erde
von: Manfred Spitzer
Schattauer, 2021
ISBN: 9783608116618 , 288 Seiten
Format: ePUB
Kopierschutz: Wasserzeichen




Preis: 19,99 EUR
eBook anfordern 
Vorwort
Medizin ist heute in vielfacher Hinsicht global: Werden irgendwo Fortschritte gemacht, verbreitet sich das Wissen in Windeseile über den Globus. Die Corona-Pandemie ist hierfür ein gutes Beispiel: Medizinverlage haben sich weltweit darauf geeinigt, Artikel über das neue Corona-Virus und die von ihm verursachte Erkrankung weltweit kostenlos zur Verfügung zu stellen (open access). Motto: Keiner soll leiden oder gar sterben, weil irgendwelche neuen Erkenntnisse aus Kostengründen nicht bekannt waren. Dies ist wenig bekannt, aber ich halte es für bemerkenswert. Wissen, so zeigen die Erfahrungen mit dem Corona-Virus, ist ein allgemeines Gut und eine starke Waffe gegen die Pandemie.
Im ersten Kapitel geht es um einen anderen Aspekt der Medizin: Sie betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und – diese Idee ist wesentlich jünger als die Veterinärmedizin – den gesamten Globus. Wenn auch schon vor etwa 50 Jahren die Gaia-Hypothese des Briten James Lovelock formuliert wurde, die besagt, dass die Erde und ihre Biosphäre wie ein Lebewesen betrachtet werden könne, so erfuhr die Idee von der Gesundheit des Planeten Erde erst im letzten Jahrzehnt größere Verbreitung. Dies liegt u. a. daran, dass das Thema der Erderwärmung in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist, nicht zuletzt im Rahmen der »Fridays-for-Future«-Bewegung (Kapitel 2).
Nach so viel geballter, wichtiger, aber vielleicht trockener Wissenschaft sei dem Leser dann erst einmal ein Krimi gegönnt (Kapitel 3), ein Psychiatrie-Krimi noch dazu. Zugleich ist es die Geschichte der meist zitierten Arbeit aus diesem Fachgebiet (publiziert im Fachblatt Science im Jahr 1973), von der sich herausstellte, dass sie zum großen Teil erfunden war. Der anschließende Beitrag (Kapitel 4) bleibt dann auch bei diesem Thema und widmet sich allgemein dem Problem der Replikation psychologischer Arbeiten. Der als Replikationskrise bezeichnete Sachverhalt ist wichtig, seine Diskussion war dringend nötig und wird die Psychologie letztlich stärken: Denn was nützen Ergebnisse, auf deren Gültigkeit man sich nicht verlassen kann? Wissenschaft schafft Wissen, und »Wissen« nennen wir nur, was auch wirklich stimmt und worauf wir uns genau deswegen auch wirklich verlassen. Aber auch wenn wir etwas noch nicht zu 100 Prozent (also mit absoluter Sicherheit) wissen, dann gibt es zwischen dem Licht des Wissens und dem Dunkel des Unwissens auch noch Graustufen, also Grade der Evidenz (Kapitel 5), die für die Bewältigung des Alltags durchaus relevant sind: »Ich habe es auf dem Wochenmarkt als Gesprächsfetzen aufgeschnappt« gilt nicht so viel wie »mein bester Freund hat es mir gesagt«, und das wiederum gilt nicht so viel wie »ich habe es selbst gesehen«.
Wissen setzt Verständigung und Vertrauen voraus, und damit wiederum haben wir Menschen so unsere Probleme. Dass diese Probleme eher keine Lösung in theoretischen Auseinandersetzungen am grünen Tisch haben, sondern eher in der gelebten Alltagspraxis, beispielsweise auf dem Fußballrasen, zeigt Kapitel 6. Das gemeinsame Spielen kann Vorurteile abbauen, zwar nicht unter allen Umständen, aber unter bestimmten Rahmenbedingungen schon. Dies wird wichtig sein, wenn wir die vorherigen fünf Kapitel ernst nehmen und die Wahrheit suchen, wenn es darum geht, wie (und wer und wie viele) Menschen künftig leben können. Mit nationalstaatlichem Kleinklein und dem Motto »jeder gegen jeden« kann und wird man das nicht lösen, sondern nur im globalen Miteinander. Das ist sogar Voraussetzung dafür, dass wir die Wahrheit finden und dann richtig handeln (vgl. hierzu auch Spitzer 2021).
Mehrere Kapitel beschäftigen sich mit dem komplexen Wechselspiel zwischen Natur und Kultur, über das nachzudenken sich immer lohnt, weil es zu einer besseren Einordnung unserer Existenz und unseres Erkenntnisvermögens verhilft. Ein wichtiger Schritt in der Transmission von Kultur war die Erfindung der Schrift (Kapitel 7). Seit Jahrtausenden schreiben Menschen Texte und beschäftigen sich mit ihnen, speichern sie, transportieren sie und analysieren und verstehen sie immer wieder aufs Neue. Das nennt man Philologie und das gibt es daher auch seit Jahrtausenden. Seit einigen Jahrzehnten werden für den Umgang mit Texten auch digitale Werkzeuge (Computer, Internet) verwendet, aber die Art, wie wir Menschen Texte verstehen, hat sich durch diese Werkzeuge nicht geändert. Gehirne machen keine Downloads, sondern werden beim Lesen zum Verständnis gebraucht und ändern sich dadurch. Dieser Vorgang heißt Lernen. Seit Jahrhunderten werden schwer verständliche Texte geschrieben – entweder weil bestimmte Sachen tatsächlich komplex und schwer zu verstehen sind oder um ein Informationsgefälle herzustellen, das sich monetarisieren lässt. Das Unverständnis des einen ist der Gewinn des anderen. Das war schon immer so. Aber wenn dies auf institutioneller Ebene zum Prinzip und zur treibenden Kraft des Wirtschaftens wird, sollten wir uns dagegen wehren! »Medienkompetenz« kann uns dabei nicht helfen, denn es gibt sie gar nicht, es sei denn, man meint damit die Philologie.
In Kapitel 8 wird am Beispiel von Farben und Emotionen gezeigt, wie unsere Biologie in unsere Kultur hineinspielt – mehr oder weniger, je nach beobachtetem Sachverhalt oder Vorgang. Vorbei sind die Zeiten, in denen man Kultur und Biologie fein säuberlich sortieren konnte, und die Kulturwissenschaften für die Kultur und die Naturwissenschaften für die Biologie zuständig waren. Denn wir Menschen gehören auch zur Natur und unsere Kultur damit ebenfalls. Wir sind damit jedoch keineswegs vollständig determiniert. Kultur entwickelt vielmehr auch unabhängig von Natur eine Eigendynamik, sodass die Natur allein nicht ausreicht, die Unterschiede zwischen Kulturen zu erklären. Ich möchte diesen Gedanken kurz anhand weiterer Beispiele erläutern. Die Laktoseintoleranz, also der Verlust der Fähigkeit, Milchzucker zu verdauen, ist für alle Säugetiere und damit auch für uns Menschen eigentlich der Normalfall. Denn warum sollte der Körper zeitlebens ein Enzym– die Laktase – produzieren, das man nach der Stillperiode nicht mehr braucht? Aufgrund der vor Jahrtausenden aufkommenden kulturellen Neuerung der Viehzucht und Milchwirtschaft (einschließlich Käseherstellung und damit Haltbarmachung von lebenswichtigem Eiweiß) hatten jedoch Menschen mit einer Mutation, die bewirkt, dass das Gen zur Produktion von Laktase nicht abgeschaltet wird, einen Vorteil – sie konnten sich auch als Erwachsene von Milchprodukten ernähren. Die Mutation setzte sich damit durch, wobei das umso besser gelang, je früher sie auftrat: In Gegenden, wo es Viehzucht schon sein knapp 10 000 Jahren gibt, ist die Laktoseintoleranz viel seltener als in Gegenden, wo erst seit kürzerer Zeit Milch und Milchprodukte zum Speiseplan gehören. In Japan beispielsweise ist das erst seit einigen Jahrzehnten der Fall, weswegen der Anteil der Bevölkerung mit Laktoseintoleranz sehr hoch ist. Folgender Sachverhalt bestätigt diese Überlegungen nochmals eindrucksvoll: Normalerweise handelt es sich bei einem erblichen Defekt um eine ganz bestimmte Mutation. Der genetische »Normalfall« – man spricht auch vom genetischen »Wildtyp« – hingegen weist Unterschiede auf, d. h. beim Wildtyp handelt es sich um eine Vielzahl genetischer Varianten. Bei der Laktoseintoleranz ist dies umgekehrt, denn was heute »Krankheit« ist (Laktose nicht verdauen zu können), war früher der Normalfall (und damit der variantenreiche Wildtyp), wohingegen der heutige Normalfall Ausdruck einer Mutation ist (die allerdings in unterschiedlichen Regionen der Welt eine andere sein kann). Schließlich ist die Laktoseintoleranz auch ein Paradebeispiel dafür, dass die Evolution des Menschen nicht aufgehört hat, sondern vielmehr mittlerweile auch in Anpassungen des Menschen an Kultur besteht. Noch nicht besonders alt ist der Gedanke, dass Kultur der Hauptreiber der menschlichen Evolution während der letzten hunderttausend Jahre (plus/minus ein paar Jahrzehntausende) war (Wilson 2012; Henrich 2016).
Das Kapitel 9 stellt ein weiteres Beispiel für die Kultur als Treiber der Evolution des Menschen vor: den Laut »F«. Diesen gibt es in menschlichen Sprachen erst seit einigen Jahrtausenden, d. h. der Neandertaler, sofern er denn sprach (wovon man heute ausgeht), hatte diesen labiodentalen Frikativ (wie »F« in der Linguistik genannt wird) noch nicht in seinem ...




